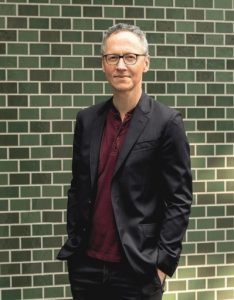 Oliver Zimmer, geboren 1963 in Thalwil (Schweiz)1https://www.zivilgesellschaft.ch/wp-content/uploads/2021/10/CV-Zimmer-Oliver.pdf, ist ein Historiker, der als Professor an der University of Oxford lehrte und sich ausführlich mit der besonderen Rolle der Schweiz beschäftigt.
Oliver Zimmer, geboren 1963 in Thalwil (Schweiz)1https://www.zivilgesellschaft.ch/wp-content/uploads/2021/10/CV-Zimmer-Oliver.pdf, ist ein Historiker, der als Professor an der University of Oxford lehrte und sich ausführlich mit der besonderen Rolle der Schweiz beschäftigt.
Biographie
Oliver Zimmer studierte an der Universität Zürich Geschichte, Soziologie und politische Theorie. 1999 machte er an der London School of Economics and Political Science seinen PhD, den Doktorgrad aus englischsprachigen Ländern. Von 1999 bis 2004 lehrte er als Assistant Professor moderne Geschichte an der University of Durham (England). 2004 wurde er Associate Professor.
Von 2005 bis 2014 war er Associate Professor in Oxford und danach zum vollen Professor befördert. Von 2014 bis 2021 lehrte er in Oxford moderne, europäische Geschichte. Seit 2022 ist er Forschungsdirektor in Zürich am privat finanzierten, politisch ungebundenen „Center for Research in Economics, Management and the Arts“ (Crema).
Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Uppsala, Tokio, München und Paris.
Zimmer besitzt die Staatsbürgerschaft der Schweiz und Großbritanniens.2https://www.oliverzimmer.ch/pagecv
Positionen
Schweiz
Über sein Buch Wer hat Angst vor Tell? Unzeitgemäßes zur Demokratie (2021) schrieben wir in Recherche D, Heft 19:
Zimmer kennt aus eigener Erfahrung wie vermutlich kaum ein Zweiter die demokratischen Sonderfälle der Schweiz und Großbritanniens, die zusammen mit Norwegen gemein haben, sich der Postdemokratie der Europäischen Union, so gut es geht, entzogen zu haben. Genau darum geht es nun ausführlich in Wer hat Angst vor Tell? Unzeitgemäßes zur Demokratie (Basel 2021). Wer Angst vor dem Schweizer Nationalheld und Freiheitskämpfer Wilhelm Tell hat, ist indes schnell ersichtlich: Es sind die Technokraten in Politik, Wirtschaft, Medien und den Gerichten, die von oben herab vorgeben, wohin sich der „Zivilisationsfortschritt“ bewegen muß.
Die Schweiz spielte hier schon immer die Rolle des Stachels im Fleisch. Denn: Obwohl sie genau das Gegenteil machte, was die Eliten in der jeweiligen Zeit als vernünftig markiert hatten, war und ist sie äußerst erfolgreich. Sehr klug fragt Oliver Zimmer so zum Beispiel danach, warum sich die französisch sprechenden Regionen der Schweiz gegen den Napoleonischen Nationalstaat entschieden? „Weil sie erwarten durften, dass ihnen der Schweizer Staatenbund mehr Freiraum lassen würde als der französische Vernunftstaat mit seiner Doktrin der einen und unteilbaren Nation.“
Die Schweiz schert nicht nur heute aus mit der direkten Demokratie. Sie ging bereits im 19. Jahrhundert einen reaktionären Sonderweg, als sie dem Nationalstaat eine Absage erteilte und ihre alten mittelalterlichen Strukturen beibehielt. Diese scheinbare Rückständigkeit sollte sich jedoch in ökonomischer Hinsicht als Erfolgsrezept der Schweiz herausstellen. Zimmer erklärt das anhand des verhältnismäßig späten Eisenbahnbaus um 1900. Die großen Nationalstaaten vernetzten lediglich die großen Industriezentren und Großstädte miteinander. Die Schweiz baute hingegen Bahnhöfe und Schienen bis in kleine Ortschaften hinein. „Dieses System erwies sich als Quelle wirtschaftlicher Produktivität“, so Zimmer.
Seiner Ansicht nach haben die „archaischen eidgenössischen Traditionen und Institutionen mehr Modernität produziert (…) als die brillant komponierten Pamphlete der grossen Staatsphilosophen“. Der Grund dafür: Die historisch gewachsenen Formen sind so biegsam, daß sie sich schneller als eine Bürokratie an die neuen Herausforderungen der Umwelt anpassen können. Es braucht nicht erst ein neues Gesetz und eine neue Behörde. Wenn ihnen eigene Verantwortung übertragen wird, sind die meisten Bürger beweglicher. Zimmer resümiert daher unter Bezugnahme auf Herbert Lüthy: „Ein kommunalistisch aufgebauter Staat ist gut (…), solange der geistige Horizont dieser Kommunen über ihren Kirchturm hinausreicht, solange sie visionär veranlagt bleiben.“ Die Schweiz beherzige das und könne somit als „anarchischer Kommunalismus ohne ordnende Hand“ charakterisiert werden.
In seinem Buch widmet sich Zimmer darüber hinaus den judikativen Übergriffen durch internationale Gerichtshöfe, die immer stärker die Legislative bevormunden. Er seziert die naive Gedankenwelt der linksliberalen „Kaste aus Geist und Geld“, die heimlich überall im Westen eine „Democracy in Name Only“ installiere. Und, er erklärt herausragend, warum die Politik der Massenmigration schlecht für die Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit ist. Hören wir ihm also noch einmal genau zu: „Weil Schweizer Löhne an der Spitze liegen, müssen auch die Produktivitätsraten hoch sein, was eine erspriessliche Herausforderung darstellt: Es besteht, wie auch in Skandinavien, ein ständiger Anreiz, in Ausbildung, in neue Technologien und in Bereiche mit hoher Wertschöpfung zu investieren. Dagegen führt ein grosser transnationaler Pool an günstigen Arbeitskräften mittelfristig meist zu einer Senkung der Kapitalinvestitionen pro Arbeitnehmer, was die Produktivitätsraten langfristig sinken lässt.“
Demokratie
Zu seinem Buch Mehr Demokratie wagen (2023) betonten wir ebenfalls in Recherche D, Heft 19:
Der Ökonom Bruno Frey und der Historiker Oliver Zimmer haben ein Buch geschrieben, in dem sie die Vorzüge der direkten Demokratie erklären. Das ist keine Überraschung, denn beide Professoren stammen aus der Schweiz. Überraschender ist hingegen, daß es einen Bruch in diesem Buch mit dem einfallslosen Titel Mehr Demokratie wagen gibt. Die historische Begründung für eine intensivere Beteiligung des Volkes, geschrieben von Oliver Zimmer, überzeugt auf ganzer Linie. Das, was sich Ökonom Bruno Frey zur Zukunft der Demokratie ausgedacht hat, sollte dagegen besser auf Wolkenkuckucksheim beschränkt bleiben.
Doch zunächst zu Zimmer: Für ihn gehören repräsentative Demokratie, Zentralisierung und die Meinungsmacht der Medien zusammen. Der Grund: In der Französischen Revolution sollte nicht nur die alte Monarchie, fälschlicherweise als »Absolutismus« bezeichnet, beseitigt werden. »Den zweiten Hauptfeind der Nation« sah der Kopf hinter der Revolution, Emmanuel Joseph Sieyès, »in den alten historischen Provinzen«, erklärt Zimmer.
Die Einheit des herzustellenden nationalen Willens sollte daher nach zwei Seiten abgesichert werden. Zum einen mußte die Krone entmachtet werden, zum anderen galt es, »jede Konzession an eine dezentrale Entscheidungsgewalt« zu verhindern. Zimmer meint, daß »es im selben Land auf Schlüsselfragen verschiedene vernünftige Antworten geben kann«. Lokale Autonomie und partizipatorische Demokratie sorgen somit für einen Wettbewerb der besten Konzepte. Der Nutzen ließe sich »vor allem am Beispiel der Fiskalpolitik« nachweisen. Referenden würden die »Zentralisierung bei den Staatsausgaben drosseln«.
Zugunsten der Herrschaft von spezialisierten Eliten wird gern argumentiert, die Bürger könnten unmöglich die Komplexität des Staatshaushaltes begreifen. Das Gegenteil ist indes richtig: Sofern die Bürger das Haushalten in ihrer Gemeinde konkret überblicken und darauf Einfluß nehmen können, kommt es zu keinen Schuldenexzessen, weil dann in den kleinen politischen Gebietskörperschaften ähnlich mit Geld umgegangen wird, wie dies Lieschen Müller auch privat macht.
Darüber hinaus widmet sich Zimmer dem »Informationsniveau in Demokratien«. Sogenannte »Populisten« müssen sich häufig anhören, die von ihnen gewünschten Volksabstimmungen führten zu einer Polarisierung zwischen zwei einfachen Antworten. Schließlich sei lediglich eine Abstimmung mit »Ja« oder »Nein« realistisch umsetzbar. In der Tat wäre das so, hätten wir eine Referendumsdemokratie zusammen mit einer starken Zentralisierung von Politik und Öffentlichkeit.
Verfolgt man die historischen Wurzeln der direkten Demokratie, fällt allerdings auf, daß sie als »Spielverderber für informelle Meinungsmonopole« wirkt, so Zimmer. Denn: Plebiszitäre Elemente gehen meistens einher mit föderalistischen Strukturen. Der Journalismus kann sich deshalb »nicht so abgehoben inszenieren wie in einer repräsentativen Demokratie«, meint der Medienwissenschaftler Michael Haller. »Man sieht dies an der enormen Sogwirkung der Hauptstädte auf die Korrespondenten. In Berlin, Paris und London ist die Machtelite mit derjenigen der Medien eng verzahnt.«
Zimmer und Frey ergänzen hierzu: Wenn Entscheidungen auf Abgeordnete und Experten begrenzt werden, behindere das die Informationsbeschaffung. Erstens gibt es keinen Anlaß für die Bürger, sich zu informieren. Und zweitens diene das demokratische Streitgespräch als wichtigster Motor der Informationsbeschaffung. Nur wer sich aktiv streitet, sucht nach Zahlen, Fakten und Daten, die seine Meinung stützen. »Länder, die ihre Bürger über ein gewisses Maß an lokaler Autonomie und die aktive Teilnahme am Staatsaufbau in den Zustand der Mündigkeit versetzen, haben deshalb auch im Zeitalter der Globalisierung viele Stärken aufzuweisen«, betont Zimmer. Die bedeutendste Stärke sei dabei »Systemskepsis«. Denn: »Eine derart strukturierte Demokratie basiert auf der Einsicht, dass es den perfekten Staat nicht gibt: dass es diesen in einer freiheitlichen Demokratie niemals geben kann.«
Die Parallelen zum marktwirtschaftlichen Wettbewerb liegen eigentlich auf der Hand. Doch vermutlich wäre die Stärkung der Bürgerbeteiligung in den Kommunen eine zu naheliegende Lösung gewesen und hätte wenig originell gewirkt. Bruno Frey wollte aber anscheinend den ganz großen Wurf landen und skizziert deshalb in Mehr Demokratie wagen die Idee, neue, künstliche Gebietseinheiten zu kreieren, die er als »functional overlapping competing jurisdictions« (FOCJ) bezeichnet. Eine solche Zone könnte der Bodenseeraum grenzüberschreitend bilden. Doch wozu? Wettbewerb und Vielfalt entstehen doch gerade erst dann, wenn in Konstanz andere Ideen umgesetzt werden als in Friedrichshafen oder Bregenz.
In diesem Sinne: Mut zur Vielfalt! Mut zur Demokratie! Und: Mut zur Herkunft! Eine »Neuorganisation des (…) Territoriums« auf dem »geometrischen Reißbrett« (oder gemäß irgendwelcher von oben diktierten Kriterien) zerstört lokale Autonomie. Das steht übrigens ebenfalls in dem Buch auf den Seiten von Oliver Zimmer. Vielleicht hätte er besser ein eigenständiges Werk verfaßt.
Bürokratie der Europäischen Union
In der NZZ schrieb Oliver Zimmer zusammen mit Heinrich Fischer am 5. April 2025:
„Die EU-Administratoren sind sogar stolz darauf, jeweils als Erste minuziös Einschränkungen für neue Entwicklungen gesetzlich zu regeln, meist noch bevor klar ist, wo Nutzen und möglicher Schaden dieser Innovationen liegen. Niemand soll sich aus ungeregeltem Freiraum einen Vorteil verschaffen können. Doch die Möglichkeit, sich durch Innovationen Vorteile zu erarbeiten, ist der Magnet, der die besten Ideen, die besten Köpfe und das nötige Kapital anzieht.
Die USA funktionieren umgekehrt; ebenso immer mehr auch China, wo für neue Ideen der Weg geebnet wird, bis dann später, wenn nötig, der Staat das Zepter übernimmt. Er gibt zunächst viel Freiraum und regelt erst, wenn erkennbar wird, wo genau Innovationen mehr Schaden als Nutzen anrichten.
(…)
In der Schweiz vertrauen laut aktuellen Zahlen über 60 Prozent der Bürger ihrem Staat, was doppelt so viele sind wie in der EU. Der Grund für diese Differenz ist unschwer zu erkennen: Selbst- und Mitbestimmung, zwei Säulen der Schweizer Gesellschaftsordnung, begünstigen Selbstverantwortung und Mitverantwortung für das Ganze; sie bilden die Grundlage für Selbstvertrauen und für Vertrauen in andere. Und dieses Vertrauen ist der wichtigste Faktor zur Reduktion sozialer Komplexität. Und so schliesst sich der Kreis. Man begreift, warum doppelt so viele Schweizer Bürger und Bürgerinnen ihrem Staat vertrauen wie EU-Bürger der EU.“
Liberalismus-Kritik
„Nachhaltig erfolgreich war der Liberalismus vor allem dort, wo er entschieden bürgerlich war, will sagen: wo er der Versuchung geschichtsphilosophischer Projektionen zu widerstehen vermochte. Dieser bürgerliche Liberalismus hat mit dem Citoyen mehr gemein als mit dem Bourgeois, und doch unterscheidet er sich deutlich von beiden. Sein Hauptmerkmal ist die demokratisch-genossenschaftliche Orientierung, die seinen Freiheitsbegriff ebenso durchdringt wie sein Rechtsverständnis“, betont Zimmer in einem anderen Beitrag für die NZZ vom 6. August 2024. Die Liberalen von heute kranken ihm zufolge daran, daß sie sich als Teil „einer kosmopolitischen Avantgarde“ verstehen und Utopien anhängen.
Veröffentlichungen (Auszug)
2024: Prediger der Wahrheit: Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft
2023: Mehr Demokratie wagen. Für eine Teilhabe aller (zusammen mit Bruno Frey)
2021: Wer hat Angst vor Tell? Unzeitgemässes zur Demokratie
2003: Nationalism in Europe, 1890-1940
Wikipedia-Korrektur
Der Wikipedia-Beitrag über Oliver Zimmer ist objektiv gehalten, aber seine Positionen werden äußerst verkürzt referiert. Diesbezüglich haben wir ausführliche Ergänzungen vorzuschlagen.
(Bild Oliver Zimmer: Von: Tom Haller)
